Katja Gentinetta / Niko Paech: Wachstum?, hrsg. v. Lea Mara Eßer, Frankfurt am Main: Westend Verlag, 2022 (= Reihe Streitfragen), ISBN: 978-3-86489-350-6, 107 Seiten, 14,00 €
Rezension von Markus Henning
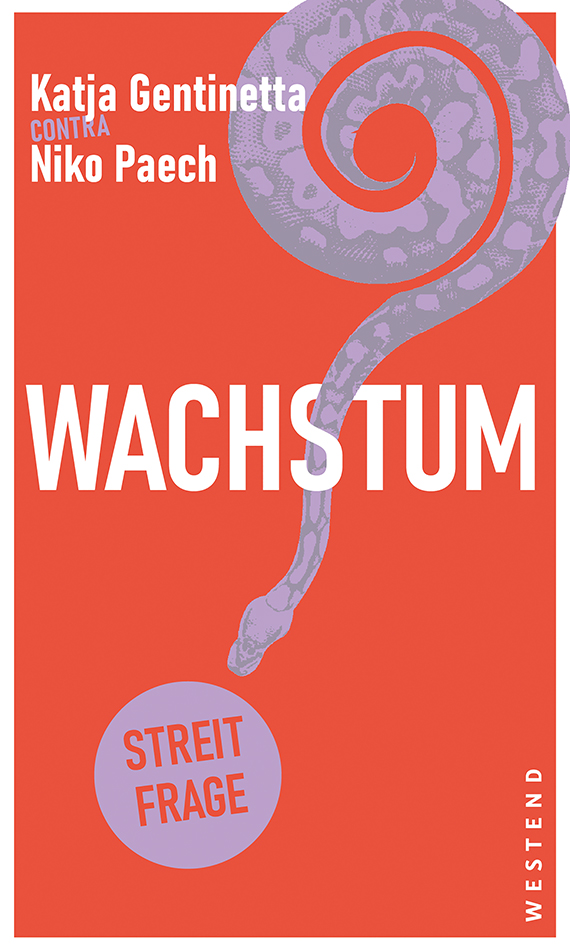
Unser Lebensstil basiert auf Wirtschaftswachstum, Technisierung und ökologischem Vandalismus. Er betreibt Raubbau an der eigenen Substanz. Was wird von unserer Wohlstandsarchitektur übrigbleiben, wenn wir endlich Verantwortung für ihre Nebenwirkungen übernehmen? Wo liegt die Obergrenze verfügbarer Konsum-, Mobilitäts- und Technikoptionen unter der Bedingung globaler Gerechtigkeit? Welche Anspruchsmäßigungen kommen auf uns zu? Wie können wir unser Handeln in der Welt reduktiv so verändern, dass die irdischen Lebensgrundlagen dauerhaft erhalten bleiben?
Für die Aushandlung tragfähiger Antworten braucht es mehr denn je eine vielstimmige Gesellschaft. Eine solche bildet sich aber erst jenseits eingefahrener Routinen im gemeinsamen Dialog. Nur wenn divergierende Standpunkte sich auf Augenhöhe begegnen, verliert allzu Selbstverständliches seine trügerische Sicherheit, können Gedanken sich klären und Neues entstehen. Einen Raum des Gesprächs öffnet jetzt der Frankfurter Westend Verlag. Der erste Band seiner neuen Reihe Streitfragen thematisiert den Wachstumszwang kapitalistischer Ökonomien und die daraus entstehenden Folgerungen.
Zu Wort kommen die Schweizer Philosophin Katja Gentinetta (geb. 1968) und der deutsche Volkswirtschaftler Niko Paech (geb. 1960). Beide haben ausreichend Platz erhalten, um ihre je eigene Betrachtungsweise zu entfalten – allerdings ohne Kenntnis des jeweils anderen Beitrages. Eine Spielregel, die im Ergebnis gerade dadurch argumentative Funken schlägt, dass beide Seiten unterschwelligen Rechtfertigungs- und Überbietungszwängen entgehen.
So ist die Lektüre vor allem eine Einladung zum Selberdenken, zum Abwägen, zur selbstkritischen Überprüfung eigener Überzeugungen. Diese produktive Verunsicherung ist auch für die Freiwirtschaft von vitalem Interesse. Zumindest implizit und nicht zuletzt geht es hier um ihre eigene Zukunftsfähigkeit.
Bekanntlich fordert der freiwirtschaftliche Ansatz eine grundlegende Geld- und Bodenreform mit einer umlaufgesicherten, effektiv mengengesteuerten Währung und einer pächtersozialistischen Aufhebung des Privateigentums an Grund, Boden und natürlichen Ressourcen. „Freiland“ und „Freigeld“ würden dazu führen, dass die Pachterträge der Allgemeinheit zugutekommen und der allgemeine Zinsfuß sich langfristig auf null Prozent einpendelt. Sozialökonomisches Leitbild ist die Befreiung der Marktwirtschaft vom Kapitalismus.
Dass sie genau diese Zielvorstellung zurückweist, fällt bei den Ausführungen von Katja Gentinetta (S. 9-55) zuallererst ins Auge. Marktwirtschaft und Kapitalismus sind für sie zwei positiv zu bewertende Seiten derselben Medaille. Ebenso behauptet sie die unhintergehbare Abhängigkeit menschlicher Wohlfahrt und Lebensqualität von einer permanenten Steigerung des Bruttoinlandsproduktes (BIP), also des Gesamtwerts der jährlich produzierten Waren und Dienstleistungen. Nicht von ungefähr lautet der Titel ihres Essays: Wachstum heißt Entwicklung.
Jede Strukturveränderung muss nach Gentinettas Ansicht das gesamte Wirtschafts- und Gesellschaftssystem in eine Abwärtsspirale des Elends reißen: „Die verschiedenen Faktoren – Unternehmen, Arbeitsplätze, Einkommen, Konsum, Kredite und Investitionen – sind miteinander verknüpft und unterstehen in einer kapitalistischen Wirtschaft allesamt der Wachstumslogik. Deshalb kann auch nicht einfach eines der zentralen Elemente einer solchen Wirtschaft – sei es das Geld, der Wettbewerb oder der technologische Fortschritt – wie ein Puzzlestein herausgelöst werden, um diesen Kreislauf zu durchbrechen“ (S. 39).
So selbstbewusst diese These im Raum steht, so fragwürdig ist ihre inhaltliche Herleitung. Gentinetta verzweigt von der ökonomischen auf eine vermeintlich anthropologische Begründungsebene – und endet bei einem sozialdarwinistisch anmutenden Zirkelschluss: Nicht „das System“ handle, sondern „die Menschen“ in ihm. Letzteren schreibt Gentinetta Motivlagen zu, die sie ganz offensichtlich dem homo oeconomicus entlehnt hat, wie er bei neoklassischen Wirtschaftsmodellen beliebt ist. Losgelöst von jeder soziokulturellen Einbindung und fern jeder überindividuell geteilten Ethik legt das Menschenbild des homo oeconomicus die Wirtschaftsakteure auf die Rolle selbstbezogener Nutzenmaximierer fest (Ansatz des definitorischen Egoismus). Diese Wesenseigenschaften aber seien die letztendliche Triebkraft kapitalistischer Dynamik. Ergo: „Der Wachstumszwang der Wirtschaft entspricht dem Überlebensdrang in der Natur“ (S. 29).
In Wirklichkeit sind menschliches Streben und soziale Handlungsoptionen – ebenso wie ökonomische Strukturen und Dynamiken – immer das historische, also prinzipiell veränderbare Ergebnis gesellschaftlicher Entwicklungen. Ihre naturalisierende Festschreibung als alternativlose „Tatsachen“ ist keine tragfähige Begründung: Schon gar nicht, um emanzipatorischen Reformanstrengungen den Wind aus den Segeln zu nehmen!
Und dennoch lohnt es sich, Gentinettas Gedankengang gerade dort weiterzuverfolgen, wo sie sich mit den zerstörerischen Seiten der kapitalistischen Expansion befasst. Ihre Lösungsvorschläge stimmen weitgehend mit dem überein, was aktuell in weiten Teilen von Politik und Zivilgesellschaft als „ökologische Modernisierung“, als „nachhaltiges“ oder „grünes Wachstum“ verhandelt wird.
Hiernach geht es darum, existentielle Verheerungen wie Ressourcenverbrauch, Umweltschäden, Überkonsum und Klimawandel zu monetarisieren und als „externe Kosten“ in Produkte und Dienstleitungen verursachergerecht einzupreisen (z.B. über eine CO2-Steuer oder die Erhöhung von Energie- und Stromtarifen). Darüber hinaus – und dieser Punkt ist für den Wachstumsdiskurs besonders wichtig – wird dem gesteigerten Einsatz neuer, umweltschonender Technologien eine entscheidende Funktion für die Überwindung bestehender Nachhaltigkeitsdefizite zugewiesen. Auch Gentinetta fordert, diesem Bereich industrieller Innovation durch staatliche Anreize verstärkten Anschub zu geben.
Ihre abschließende These: Eine Steigerung wirtschaftlicher Leistung ist die Voraussetzung technologischer Entwicklung. Daher können die Probleme, die das Wirtschaftswachstum bisher erzeugt hat, gerade nicht durch seine Unterbindung gelöst werden, sondern nur durch seine Fortführung und innovationsgestützte Umlenkung in eine weniger schädliche Richtung.
Der genauen Gegenthese folgt Niko Paech in seinem Beitrag Wirtschaftswachstum als essentielle Bedrohung (S. 57-99). Er dekonstruiert gerade diejenigen Korrekturprogramme, die einer strukturkonformen Steigerungslogik folgen, und entwirft im Anschluss das Transformationsszenario einer konsequenten Postwachstumsökonomie.

Ausgangspunkt seiner Argumentation ist die Beobachtung, dass keine BIP-relevante Leistung ohne Weltverbrauch zu haben ist. „Externe Effekte“ sind keine Nebenfolge, sondern die Voraussetzung industrieller Wohlstandsvermehrung. Selbst die ökologisch ambitioniertesten technischen Neuerungen verursachen durch ihre Herstellung, ihren physischen Transfer, ihre Nutzung und Entsorgung zusätzliche Flächen-, Materie- und Energieverbräuche („Materielle Rebound-Effekte“). Mit Effizienzerhöhungen und zusätzlich induzierten Geldflüssen erhöhen sie zudem die allgemeine Kaufkraft, was als gesteigerte Nachfrage abermals die produzierte Gütermenge wachsen lässt („Finanzielle Rebound-Effekte“).
Auch durch Investitionen in „grüne“ Technologien lässt sich das Wirtschaftswachstum also nicht von zusätzlichen Belastungen der Ökosphäre entkoppeln. Allein unter der Bedingung eines nicht wachsenden BIPs und eines entsprechenden Rückbaus alter Produktionskapazitäten hätten solche Technologien eine Chance, zur ökologische Entlastung beizutragen – allerdings nur, wenn gegenläufige „Rebound-Effekte“ eingedämmt werden könnten.
Seine Absage an technizistische Heilsversprechen verbindet Paech daher mit dem Appell, unsere Ökonomie materiell abzurüsten. Da unser Planet physisch limitiert ist, muss es eine Obergrenze für die Verteilungsmasse geben, die jedes Individuum gerechterweise für sich beanspruchen kann.
„Dies lässt sich am weithin akzeptierten Zwei-Grad-Klimaziel exemplarisch verdeutlichen: Bei globaler Gleichverteilung der damit kompatiblen Gesamtmenge an CO2-Emissionen auf ca. 7,8 Milliarden Menschen ergäbe sich ein Budget von circa einer Tonne pro Jahr. Tatsächlich liegt dieser Wert in Deutschland bei rund elf Tonnen. Allein deshalb wäre der materielle Wohlstand im globalen Norden schrittweise zu reduzieren, um ihn im globalen Süden begrenzt und punktuell anheben zu können“ (S. 88 f.).
Ein derartiges Herunterdrosseln technisierter und globaler Wertschöpfungsprozesse wäre durchaus anschlussfähig für freiwirtschaftliche Konzepte. In seiner Strukturanalyse benennt auch Paech den Verwertungsdruck eingesetzter Kapitalien – also den Zwang, Zinsen und Renditen für Eigen- oder Fremdkapitalgeber zu erwirtschaften – als einen der entscheidenden Wachstumstreiber. Gerade diesen Expansionsdruck will die Freiwirtschaft mit ihrer Geld- und Bodenreform verringern. Viel lernen könnte sie ihrerseits von dem konstruktiven Programm, das Paech für die ökonomische Neustrukturierung vorschlägt.
Es trägt anarchistische Züge. Paech setzt auf uns als lernende, uns selbst befähigende Subjekte. Er mahnt uns zum Verlassen der Komfortzone und zum experimentellen Beginnen. Nur wenn sich genügsame Gegenkulturen schon heute dezentral und kleinräumig entfalten, kann ein Reservoir an vorbildhaften sozial-ökologischen Praktiken erstehen. Erst diese Reallabore erbringen den Beweis, dass eine durch freiwillige Selbstbegrenzung qualitativ angereicherte Lebenskunst und auf sie ausgerichtete Versorgungs- und Unternehmensstrategien auch gesamtgesellschaftlich das destruktive Wachstumsdogma ersetzen können.
In diesem Sinne ist für Paech der Weg das Ziel. An seinem Ende zeichnen sich die Konturen eines vierstufigen Säulenmodells ab. Durch seinen prozessualen Aufbau könnte ein attraktives Dasein mit minimalem Bedarf an industrieller Massenfertigung, Techniknutzung und Verkehr erwirkt werden. Die sich gegenseitig ergänzenden Momente lassen sich wie folgt beschreiben:
1) Suffizienz, also die virtuose Minimierung eigener Konsumbedarfe.
2) Subsistenzaktivitäten, die industrielle Güterproduktion durch unbezahlte und marktfreie Eigenherstellung bzw. durch Gemeinschaftsnutzung und Bestandserhalt ersetzen. Konsumenten entdecken eigene Potentiale und werden zu „Prosumenten“.
3) Regionalökonomie, definiert durch partizipative Beziehungen zwischen Nachfragern und Erzeugern, durch Dezentralität und limitierte Betriebsgrößen.
4) Eine deutlich verkleinerte Industrie mit der Funktion, „(…) einen ökologisch verantwortbaren, nicht wachsenden Bestand an Gütern zu erhalten und qualitativ zu verbessern. Die Neuproduktion würde sich auf den Ersatz der nach Ausschöpfung aller nutzungsdauerverlängernden Maßnahmen nicht mehr zu ‚rettenden‘ Objekte beschränken“ (S. 97).
Niko Paech zeichnet das Bild einer sozial integrativen Postwachstumsökonomie, die sich in einer gestaltbaren Balance zwischen Selbst- und Industrieversorgung entfaltet.
In dem skizzierten Transformationsprozess hätten auch die freiwirtschaftlichen Ideen ihre Tragfähigkeit unter Beweis zu stellen – nicht nur im ideellen Wettstreit der unterschiedlichsten Wirtschaftsmodelle, sondern vor allem auch im praktischen Leben. Zu denken wäre etwa an die kommunale und regionale Ressourcenbewirtschaftung oder an ein freiwirtschaftliches Wildcat-Banking. Die Zeit ist überreif. Ohne zivilgesellschaftliche Aktion können wir der Katastrophen nicht mehr Herr werden. Mit dem Buch Wachstum? bietet uns der Westend Verlag eine wichtige Handreichung.