Amartya Sen: Rationale Dummköpfe. Eine Kritik der Verhaltensgrundlagen der Ökonomischen Theorie, aus dem Englischen übersetzt v. Valerie Gföhler, mit einem Nachwort v. Christian Neuhäuser, Ditzingen: Philipp Reclam jun. Verlag, 2020 (= Reclams Universal-Bibliothek; 14064), ISBN 978-3-15-014064-2, 72 Seiten
Rezension von Markus Henning
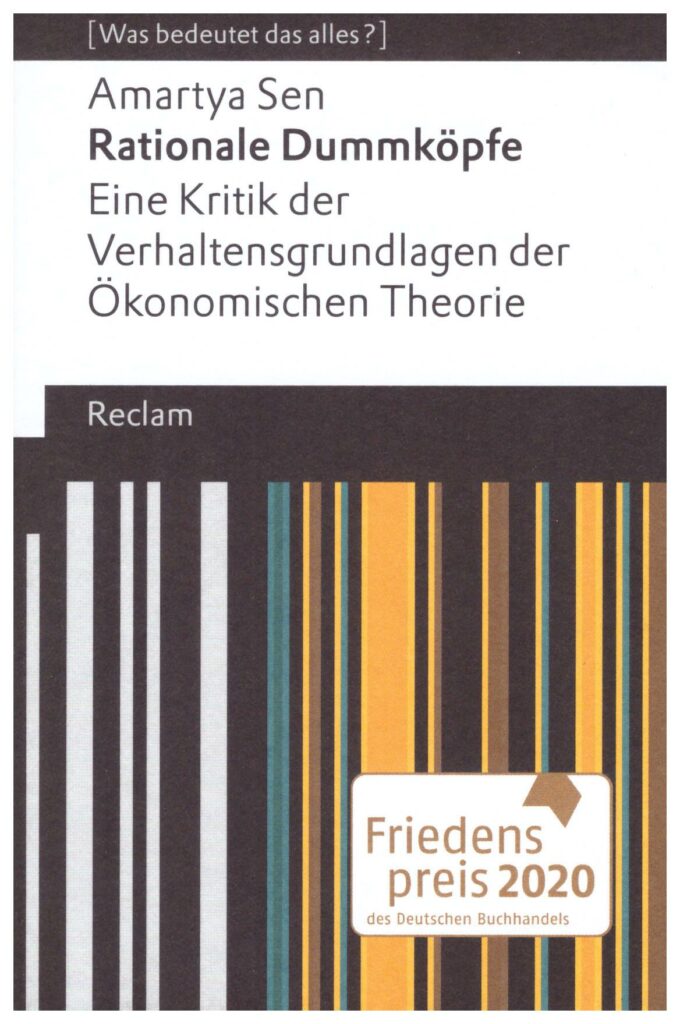
Die sozial-ökologische Transformation muss zum erkenntnisleitenden Ziel der Wirtschaftswissenschaften werden. Menschen sollen befähigt werden, ihr Leben im Einklang mit den natürlichen Ressourcen zukunftsfähig einzurichten, es besser, freier und gerechter zu gestalten.
Jemand, der seine Fachdisziplin schon seit Jahrzehnten mit genau diesem Anspruch konfrontiert, ist Amartya Sen (geb. 1933). Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph arbeitete schon früh zu gesellschaftlichen Fragen und befasste sich in empirischer Feldforschung ganz konkret mit den Bedürfnissen von Menschen, mit ökonomischer Ungleichheit, mit Armut und Hunger, mit sozialer und geschlechtlicher Benachteiligung.
Die größte Aufmerksamkeit erfahren seine Arbeiten seit jeher in interdisziplinären und anwendungsbezogenen Forschungsgebieten, z.B. in der Entwicklungsökonomie, der Nachhaltigkeitskunde, der Wirtschaftssoziologie und der feministischen Wirtschaftswissenschaft.
Im akademischen Betrieb der eigentlichen Wirtschaftsfakultäten wird er hingegen kaum rezipiert. Die tonangebenden Fachökonomen haben Sen gewissermaßen aus ihren Reihen verstoßen. Zu radikal hinterfragt der von ihm eingeklagte Paradigmenwechsel die Fundamente der vorherrschenden Lehrgebäude.
Einer der Schlüsseltexte von Amartya Sen trägt den programmatischen Titel Rational fools. Dieser ebenso grundlegende wie wegweisende Essay aus dem Jahr 1977 liegt jetzt auch in deutscher Übersetzung vor. Er ist das Ergebnis einer gleichsam archäologischen Reise durch die ideengeschichtlich abgelagerten Sedimente ökonomischer Wissensproduktion. Freigelegt hat Sen den systematischen Punkt, von dem aus jede Theoriebildung letztlich ihren Ausgang nimmt: Die jeweilige Auffassung vom menschlichen Wesen und das damit verbundene Rationalitätsverständnis.
Das ist alles andere als trivial. Es wirft ein erhellendes Licht auf viele der großen ökonomischen Modelle und zeigt sie als mehr oder weniger realitätsvergessene Abbilder einer „verwunschenen Welt der Definitionen“ (S. 16). In ihr wird das hohe Lied vom homo oeconomicus gesungen, das die Wirtschaftakteure auf die Rolle eigennütziger Nutzenmaximierer festlegt (Ansatz des definitorischen Egoismus).
Insbesondere in der neoklassischen Volkswirtschaftslehre ist jenes Menschenbild wirkmächtig geworden und wurde ausgebaut zur deskriptiven Verhaltenstheorie der rationalen Wahl. So Ehrfurcht gebietend deren mathematischer Überbau wirkt, so schlicht und tautologisch ist ihre inhaltliche Herleitung: „Gesetzt den Fall, dass beobachtet wird, dass Sie x wählen und y ablehnen, wird erklärt, dass eine Präferenz von x gegenüber y ‚offenbart‘ wurde. Ihr persönlicher Nutzen wird dann als eine numerische Repräsentation dieser ‚Präferenz‘ definiert, indem der ‚präferierten‘ Alternative ein höherer Nutzen zugeschrieben wird. Durch diese Definition kann man einer Maximierung des eigenen Nutzens kaum entkommen“ (S. 15).
Beim Methodischen bleibt Sen nicht stehen. Seine Kritik entfaltet sich inhaltlich auf zwei Ebenen:
1) Das Konzept des homo oeconomicus ist empirisch falsch. Es kann weder die soziokulturelle Einbindung menschlichen Handelns noch die individuelle Motivvielfalt in konkreten Situationen angemessen beschreiben. Vernünftiges Agieren mit dem ausschließlichen Streben nach eigenem Vorteil zu identifizieren, legt der Idee der Rationalität eine völlig willkürliche Begrenzung auf. „Eine auf diese Weise beschriebene Person […] ist tatsächlich nicht weit davon entfernt, ein sozialer Idiot zu sein“ (S. 33).
2) Dadurch wirkt das Konzept des homo oeconomicus aber in hohem Maße schädlich. Gerade in den Fragen, die für die Zukunftsfähigkeit unseres Lebens essentiell sind, presst es die Wirtschaftswissenschaft in ein Korsett systematischer Begriffslosigkeit. An erster Stelle betrifft das den Bereich der öffentlichen Güter: „In etlichen ökonomischen Modelle begegnen uns nur Privatgüter, und das ist typischerweise dann der Fall, wenn die ‚unsichtbare Hand‘ die Aufgabe hat, sichtbar Gutes zu tun“ (S. 26). Wie jede Gesellschaft ohne öffentliche Daseinsvorsorge zusammenbrechen würde, so ist deren Erhalt abhängig von einer sozial geteilten Ethik und institutionellen Rahmensetzung.
An diesem Punkt werden Sens Argumente anschlussfähig für die Freiwirtschaft. Seit jeher will sie das Geld als öffentliches Tauschmittel und den Boden als allen Menschen zustehendes Naturgut dem individuellen Gewinnstreben entziehen. Heute lassen Klimawandel und Artensterben eine Einhegung des Marktmechanismus immer dringlicher werden. Die Gedanken der Geld- und Bodenreform können den Wirtschaftswissenschaften helfen, ihre blinden Flecken zu überwinden und sich für die Zukunft zu öffnen.
(Diese Rezension wurde erstmals veröffentlicht im CGW-Rundbrief, Nr. 21/2 – September 2021, hrsg. v. den Christen für gerechte Wirtschaftsordnung, S. 10 f.)