urbanista.ch (Hrsg.): Alles super? Wie Superblocks unsere Städte zu besseren Orten machen, Autor:innen: Thomas Hug, Sarah Bühler, Simon Eggimann, Anna Paulina Graf, Marion Zängerle, Lia Zinngrebe, Constanze Ackermann und Philipp Winter, München: oekom Verlag, 2024 (= Ein Diskussionsstoff von urbanista), ISBN 978-3-98726-116-9, 96 Seiten, 20,00 € (Open Access im PDF-Format)
Rezension von Markus Henning
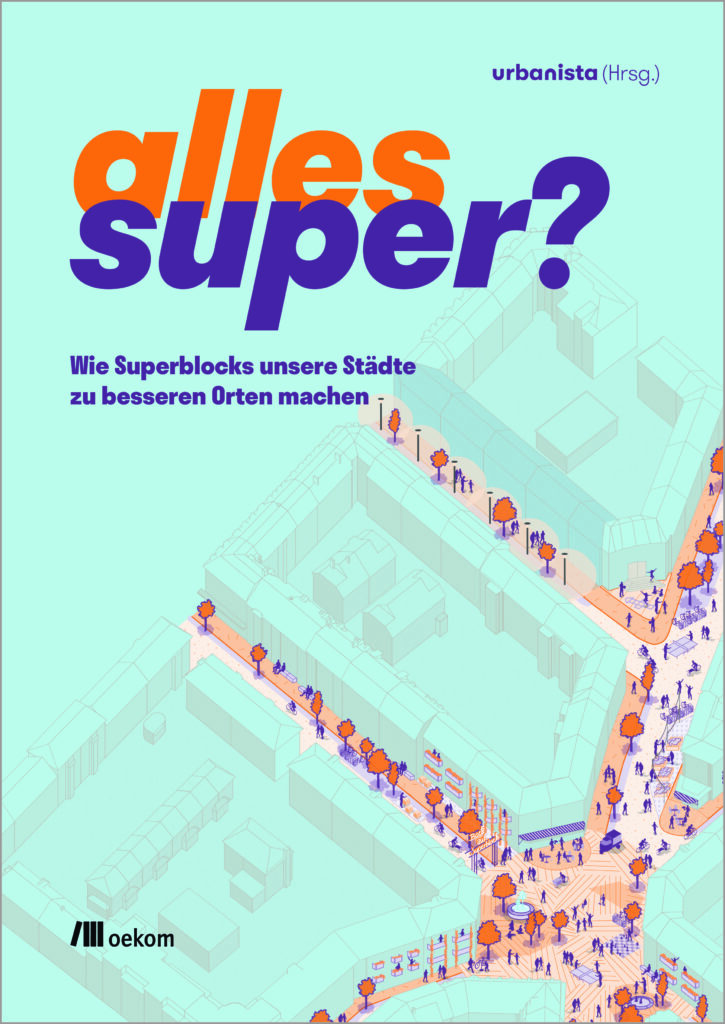
Der motorisierte Individualverkehr war niemals ein Selbstläufer. Er war auch zu keiner Zeit alternativlos. Seine Dominanz ist das Ergebnis eines Zusammenwirkens von Staatsherrschaft und fossilen Kapitalfraktionen. Hand in Hand mit der Marginalisierung anderer Mobilitätsformen haben Industrie- und Steuerpolitik, Verkehrsplanung und Straßenbau die Räume der Öffentlichkeit dem Pkw untertan gemacht. Urbanität wandelte sich spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs zur Verkehrs- und Abstellfläche von Kraftfahrzeugen.
Durchschnitten von den Artefakten des Automobilismus sind städtische Wohnumfelder auch heute noch eher Transit- als Verweilorte. Das Sich-Einkapseln in rollenden Blechkisten korrespondiert mit einer Raumkultur der Beziehungslosigkeit. Wenn es aber an Nähe, Austausch und überraschender Weltbegegnung mangelt, untergräbt das den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ihre Rechnung macht die automobile Lebensweise nicht nur in Legionen von Unfallopfern, in Natur- und Klimazerstörung auf, sondern auch in Dynamiken von Vereinsamung, Aggressivität und Hass. Dabei sind die vulnerabelsten Gruppen meist diejenigen, die selbst am wenigsten Auto fahren: Frauen, Kinder, Jugendliche und Alte, queere Personen, Migrant:innen, People of Color, Menschen mit Handicaps, Menschen in Armut.
Inklusion, Solidarität, Klima- und Sozialgerechtigkeit setzen eine Wiederaneignung der urbanen Topographie voraus. Die Flächenaufteilung zugunsten des Autos muss überwunden werden. Nur so lässt sich auf nachhaltige Weise ein Miteinander einüben, das dem Lebensrecht aller folgt.
Was Strömungen des Visionären schon in den 1960er Jahren artikulierten, hat sich über die Zeitläufe hinweg zu einer neuen Form des Munizipalismus ausgestaltet. Seit etwa einem Jahrzehnt entfalten Metropolenprojekte wie die „15-Minuten-Stadt“ in Paris, die „Superilles“ in Barcelona oder der „Grüne Korridor“ in Bogotá transnationale Leuchtkraft. Längst hat die Kooperation von Zivilgesellschaft und Kommunalverwaltungen auch andernorts Lernfelder für neue Raumproduktionen geöffnet.
Von solchen Interventionen für Dezentralität und lokale Gemeinschaft, für Begegnung, Grünflächen und Aufenthaltsqualität in Stadtquartieren handelt ein Buch, das jetzt im Münchner oekom Verlag erschienen ist. Es trägt den Titel Alles super? Wie Superblocks unsere Städte zu besseren Orten machen.
Herausgeberin ist urbanista, eine aktivistisch orientierte Agentur für Stadtentwicklung und Zukunftsstrategien mit Sitz in Zürich und Hamburg. Ihre Diskussionsstoff-Reihe, in der diese Veröffentlichung erscheint, begreift Strukturkreativität als öffentliche Ressource in einem nach vorne offenen Wandelprozess. Das Teilen von Expertisen soll zu Adaption und eigenständigen Neuschöpfungen anregen.

Selbermachen galt als Maxime auch für die insgesamt acht Autor:innen aus dem urbanista-Umfeld. Für ihr Buch reisten sie quer durch Europa, schauten sich um und mischten sich ein: In Mailand, Paris, Berlin und London, in Wien, Bern, Hamburg und Brüssel. Sie starteten eigene Projekte, durchlebten den Umbruch von Alltagsroutinen, ergänzten ihre teilnehmende Beobachtung durch Kongressbesuche und Interviews mit Fachpersonen. Das Ergebnis ihrer Feldforschung ist ein Bericht voll ganzheitlicher Transformationserfahrungen. „Die Recherche […] hat uns gezeigt: Superblocks sind supervielseitig. Und genau das macht sie so super. Denn so gibt es eigentlich keine Stadt, in der das Grundprinzip von Superblocks nicht angewendet werden kann – weniger Verkehr, mehr Raum zum Leben“ (S. 16).
1) Mobilität. Erproben lässt sich die Wiederbelebung von Urbanität am ehesten in Raumeinheiten aus benachbarten Häuserblöcken und den von ihnen umgrenzten Arealen. Ein Schlüsselelement für die Entfaltung von Superblock-Potentialen ist die Sperrung für den Kraftfahrzeug-Durchgangsverkehr. Motorisierte Verkehrsströme ohne direktes Ziel im Quartier werden konsequent um die Blöcke herumgeleitet (mittels Diagonalsperren, modalen Filtern im Straßenraum, Ampelschaltungen, Beschilderungen etc.). Der Autoverkehr von Anwohnenden, von Zuliefer- und Gewerbebetrieben erhält weiterhin Einfahrt, muss sich aber mit einem Geschwindigkeitslimit (10-20 km/h) und einem weniger durchlässigen Wegenetz abfinden. Der Rückbau von Straßenkapazitäten und die Umwidmung von Pkw-Parkplätzen sind Mittel der Wahl, um Raum für Alternativnutzungen freizuspielen. Über elektronische Hilfsmittel (z.B. Check-In-Apps) besteht die Möglichkeit, Ausgleichsplätze in umliegenden Parkhäusern zu rabattieren und im Quartier selbst dafür zu sorgen, dass Anlieferungszonen nur in Zeitfenstern genutzt werden. Bei aller Unabdingbarkeit sind das jedoch nur erste Transformationsschritte. Eine umfassende Mobilitätswende setzt zudem die Verbesserung öffentlicher Verkehrssysteme voraus. Sie braucht attraktive Rahmenbedingungen für den Fuß- und Fahrradverkehr. Und sie weiß, dass für eine Verkürzung von Wegstrecken die lokale Angebotsverdichtung aus Daseinsvorsorge, Kultur und Kleingewerbe bedeutsam ist. Auch in dieser Hinsicht bieten Superblocks neue Entfaltungsspielräume. „Besonders in städtischen Lagen konnte immer wieder nachgewiesen werden, dass weniger autozentrierte Straßen nicht weniger Umsatz bringen – im Gegenteil. Das liegt letztlich auch daran, dass Laufkundschaft erst entsteht, wenn Menschen aus ihrem Verkehrsmittel der Wahl ausgestiegen sind“ (S. 42).
2) Gemeinschaft. Widerstandsfähige Nachbarschaft fußt auf einer Balance zwischen kommerzieller Aktivierung und Aufenthaltsorten ohne Konsumzwang. Das wirft Fragen der Ästhetik auf. Über Straßenmöblierungen lassen sich attraktive Designs kreieren (Fuß- und Radwege, Bänke, Sitzecken, Brüstungen und Nischen, Wiesen und grüne Oasen, Sport- und Freizeitflächen, Flanier- und Ruhezonen, Wasserspiele, Brunnen etc.). In ihnen können Gegenseitigkeit, Fürsorge und Verantwortungsübernahme gedeihen. Wo Menschen sich wohlfühlen und gerne aufhalten, wo sie sich spontan treffen, wo sie sich zum Entspannen, zum Gespräch oder zum Spiel verabreden, haben Verwahrlosung und Kriminalität einen schweren Stand. Längst ist empirisch belegt – und Superblock-Konzepte folgen diesen Befunden –, dass jede Investition in die Aufenthaltsqualität von Wohnnahbereichen soziales Kapital generiert. Präsenz sowie daraus sich entwickelnde Vernetzungen erhöhen das Sicherheitsgefühl, öffnen Erfahrungsräume für Selbstwirksamkeit und gelebte Anarchie. „Für viele Menschen gleicht diese lebendige Atmosphäre so manchen Nachteil des Stadtlebens aus, etwa den fehlenden eigenen Garten oder die kleineren Wohnungen“ (S. 35). Geschlechter- und Generationengerechtigkeit sind im Reservoir der Stadtplanungstools angekommen – zumindest in jenem Teil, zu dem auch Superblocks gehören. Unter Maximen wie „Eyes on the Street“ (S. 34), „Wohnzimmer der Stadt“ (S. 35) oder „Gender Planning“ (S. 63) soll dafür Sorge getragen werden, dass im urbanen Raum ausnahmslos allen Menschen die Möglichkeit offensteht, sich auf Augenhöhe zu begegnen.

3) Ökologie. Auch für die Reduzierung von Treibhausgasen, für die Anpassung an Extremwetterereignisse, für die Bewahrung und Förderung von Biodiversität lassen sich in Superblocks vorbildhafte Praktiken beobachten. Die Entsiegelung ehemaliger Verkehrsflächen öffnet Raumgestaltungen für Klima- und Artenschutz. Sie folgen CO2-armen Bewegungs- und Konstruktionsmustern. Sie sagen Lärmbelastung, Luft- und Lichtverschmutzung den Kampf an. Und sie orientieren auf die Abkühlung ehemaliger Hitzezonen im Quartier. Für ihren Wiederanschluss an natürliche Kreisläufe muss die Stadt auch als Lebenswelt von Tieren und Pflanzen kultiviert werden. Wirkmächtig ist das sog. „Trittsteinkonzept“ (S. 72). Es beschreibt die Anlage ökologischer Vernetzungskorridore aus Biotopen mit einer Fläche von mindestens vier Quadratmetern, die jeweils nicht weiter als 50 Meter auseinanderliegen. Sie bieten zahlreichen, teils seltenen Arten eine Heimat, helfen ihnen bei der Verbreitung im Stadtgebiet und bei der Wanderung zu großflächigen Schutzarealen. Besonders zu achten ist auf eine Steigerung der Baumkronenfläche in extensiven Bepflanzungen, die sich an Standortbedingungen ausrichten und Prinzipien der Diversität folgen. „Durch eine Verbreiterung der Baumscheiben, dem Bodenbereich rund um einen Baum, soll die Resilienz der Bäume gesteigert werden. Denn großräumige, permeable Baumscheiben können bei Niederschlag das Regenwasser auffangen und es bei Trockenheit an die Bäume und Pflanzen zurückgeben“ (S. 61). Ebenso können „Trittstein“-Mosaike aber auch aus temporären Begrünungselementen bestehen (Hochbeete, Pflanzentröge etc.), aus begrünten Balkonen, Fassaden und Flachdächern, aus „Pocket Parks“ (S. 70) oder Gemeinschaftsgärten. Die Einrichtung eines Superblocks kann Impuls dafür sein, der Natur in Bereichen von Wildwuchs und Durcheinander freien Lauf zu lassen. „Sie gewinnen dafür die Chance, dass ein lebenswertes Quartier entsteht, in dem sich die Bewohner:innen aktiv an der Pflege und Weiterentwicklung der Außenräume beteiligen und dabei ein tragendes soziales Netz entwickeln“ (S. 73).
4) Transformation. Geschichten des Gelingens schreiben Superblocks immer dann, wenn sie sich in jedem Schritt ihrer Realisierung bereits als Übungsfelder für Teilhabe und Selbstbestimmung bewähren, wenn sie Nachbarschaft also nicht als Zustand, sondern als partizipativen Prozess begreifen. Damit aber – hierauf wollen wir Nachdruck legen – kommen sie dem sehr nahe, was im Diskurs des Anarchismus als präfigurative Politik verhandelt wird. Greifbar wird diese Nähe in einem Ansatz, der besonders in der Anfangsphase vieler Superblock-Projekte Anwendung findet: „Tactical Urbanism bezieht sich auf kurzfristige, kostengünstige und oft experimentelle Interventionen in städtischen Räumen, die darauf abzielen, positive Veränderungen in der Gemeinschaft und der Umwelt zu bewirken. Diese Maßnahmen sind in der Regel temporär und flexibler als traditionelle städtebauliche Projekte. Ziel ist es, durch kleine, rasche Eingriffe positive Auswirkungen zu erzielen, das nachbarschaftliche Leben zu verbessern und innovative Lösungen für städtebauliche Herausforderungen zu testen“ (S. 24). Durch Einbindung der jeweiligen Bedürfnisse und Gegebenheiten sollen die Möglichkeiten vor Ort ausgelotet, basisdemokratisch geweitet und schließlich in Langfrist-Perspektive verstetigt werden. „Diese Veränderungen brauchen Zeit – möglicherweise Jahrzehnte, aber jeder Fortschritt ist wichtig, um zu zeigen, dass Veränderung möglich ist und erfolgreich sein kann“ (S. 26). Mit derart langem Atem kann die sozial-ökologische Transformation von Städten zu einer Freiraumarchitektur der Emanzipation werden. Ihr Vorgriff auf eine Zukunft der Herrschaftsfreiheit entfaltet utopische Kraft und Erwartungshorizonte, die aus sich selbst heraus Wirksamkeit erzeugen.
Alles super? Wie Superblocks unsere Städte zu besseren Orten machen steckt voller Handlungswissen. Es ist ein buchgewordenes Plädoyer für das Hinsehen, für das Mitdenken und für das offene Leben in angefochtenen Zeiten. Die Lektüre entsiegelt unseren Blick und führt uns vor Augen, dass wir keine Opfer der Strukturen sind, sondern Dinge selbst in die Hand nehmen können. Es liegt an uns, ob die Stadt der Zukunft ein Archipel verkehrsberuhigter Inseln sein wird. Wir wünschen diesem Buch viel Erfolg, weite Verbreitung und ein begeisterungsfähiges Publikum.