Harald Welzer: Alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2019, ISBN 978-3-10-397401-0, 320 Seiten
Rezension von Markus Henning
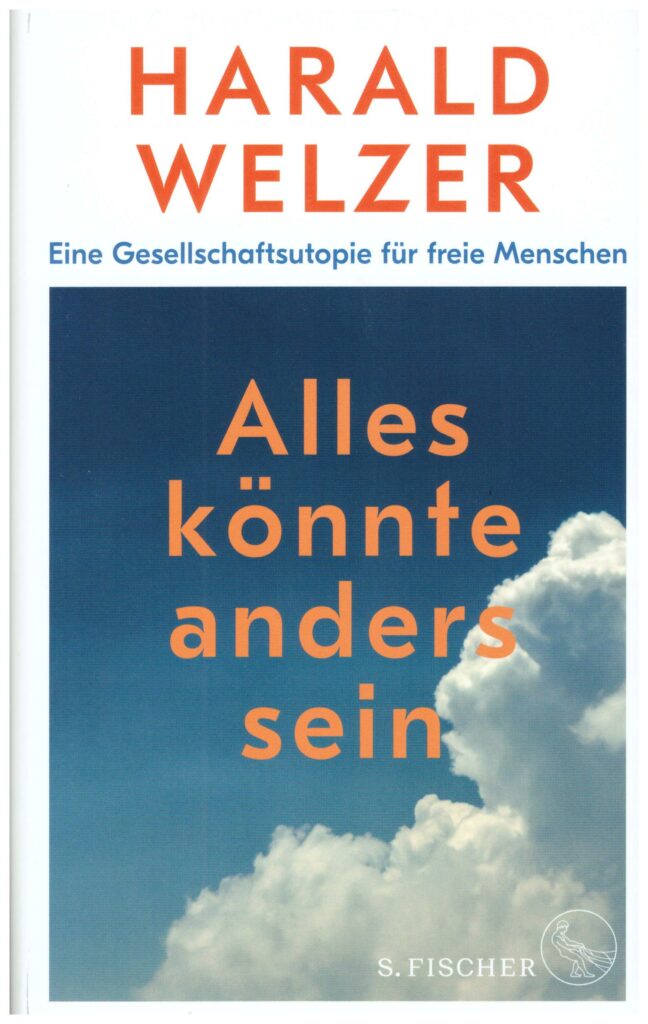
Utopie muss Spaß machen! Sie braucht attraktive Zukunftsbilder. Und sie braucht Handlungsformen, die einen Vorgeschmack genau dieser Zukunft ins Hier und Jetzt holen: Einübungen in ein besseres Leben und in eine bessere Sorge um die Natur. Auf Öffnung und Ausbau solcher Erfahrungsräume setzt Harald Welzer. In seinem neuen Buch entwirft er den sozialökologischen Wandel als modulare Revolution. Sie geht davon aus, „[…] dass das meiste, was wir für eine Gesellschaft für freie Menschen brauchen, schon da ist. Man muss es nur auseinandernehmen, anders wieder zusammensetzen und den Illusionisten der Gegenwart um die Ohren hauen“ (S. 290).
Welzer nimmt das kulturgeschichtliche Projekt der Moderne beim Wort. Er klagt den Erhalt und die Weiterentwicklung ihrer zivilisatorischen Standards ein – und zielt mitten ins Herz kapitalistischer Zerstörungslogik: Globale Teilhabe an immateriellen Gütern wie Demokratie, Freiheit, Recht, Bildung, Gesundheit und Versorgung bleibt unerreichbar, wenn unsere natürlichen Lebensgrundlagen weiterhin untergraben werden. Ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit, persönlicher Autonomie und verfügbarer Zeit ist nur möglich bei einem Weniger an Zwang, Gewalt und Weltverbrauch!
Es geht es nicht allein um Wiedergutmachung, was an Mensch, Tier und Umwelt bereits kaputt gemacht wurde. Es gilt, die „Zivilreligion des Wachstums“ (S. 43) zu überwinden und neue Entwicklungspfade zu eröffnen. Das ist keine Sache für technische, wissenschaftliche oder politische Eliten. Kein Masterplan, der von oben verordnet werden könnte. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen schließt Hierarchien aus! Nachhaltige Praktiken sind von ihnen selbst in ihrer jeweiligen Lebenswelt aufzuspüren, zu projektieren und vor allem zu erproben. Viele unterschiedliche Orte mit vielen unterschiedlichen Geschichten ergeben „ein Mosaik gelingender Verbesserungen der Welt“ (S. 188). Sie zielen auf gelingende soziale Beziehungen, sinnstiftende Ästhetik und die Entwicklung eigener Strukturen von Produktion und Konsumtion. Kleine Transformationen, die im Idealfall zusammenwirken, ein plurales Universum konkreter Utopien bilden und vorwärtsweisende Impulse setzen. Ohne sie ist der anstehende Epochenwechsel nicht zu bewältigen.
Ein Modell experimenteller Basisdemokratie, das anschlussfähig ist auch für die Freiwirtschaft! Beide Ansätze könnten zusammengehen und sich gegenseitig gut ergänzen.
Der freiwirtschaftliche Diskurs fordert schon seit über 100 Jahren eine vom Kapitalismus befreite Marktwirtschaft.
In ähnliche Richtung weist Welzers Leitbild, der Wirtschaft wieder „eine dienende Funktion“ (S. 216) zuzuweisen. Bereits praktizierte Ansätze gibt es zuhauf: Von Genossenschaftsformen, Commons und Regionalwert AGs bis hin zu solidarischen Landwirtschaften und neuen lokalen Wirtschaftsweisen. Am Beispiel von Regiogeld-Experimenten erwähnt Welzer an einer Stelle auch die Idee, den „Zins als Wachstumstreiber aus[zu]schalten“ (S. 167) – allerdings ohne den Gedanken konzeptionell weiter zu entwickeln und für die Postwachstums-Debatte fruchtbar zu machen. Die Überzeugungskraft seiner Ausführungen könnte an diesem Punkt deutlich erhöht werden durch Rückgriff auf freiwirtschaftliche Expertisen. Sie bieten eine inhaltliche Durchdringung der zinsbedingten Steigerungslogik kapitalistischer Ökonomien. Und sie entwerfen eine gangbare Alternative: Durch periodischen Wertverlust unter Umlaufzwang gesetztes, effektiv mengengesteuertes Freigeld.
Seine systemische Ergänzung ist das Freiland, die zweite Säule des freiwirtschaftlichen Reformbaus: Grund, Boden und natürliche Ressourcen sollen entkapitalisiert und in gesellschaftliches Eigentum überführt, die Nutzungsrechte im Meistbietungsverfahren vergeben werden. Auch hierfür gibt es bei Welzer direkte Anknüpfungspunkte, in Bezug auf die Nutzungsvergabe sogar sinnvolle Ergänzungen: „Eine Gesellschaft für freie Menschen muss schon aus Gründen sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe dahin zurückkommen, dass Boden im öffentlichen Besitz bleibt – private Nutzungen kann man über das Erbbaurecht oder über Vergabeverfahren für Grundstücke organisieren, die sich nicht am höchsten Gebot, sondern am höchsten Nutzen für das Gemeinwohl orientieren“ (S. 226).
Die Rückverteilung der Nutzungsentgelte ist wiederum eine Idee aus der freiwirtschaftlichen Diskussion. Sie würde dem Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens, wie es auch Welzer vertritt, zusätzliche Plausibilität verleihen.
Aber auch jenseits aller Detailfragen lohnt der Dialog. Die Gesellschaftsutopie von Harald Welzer hat inspirierende Kraft, strahlt Empathie und tiefe Weisheit aus: Letztlich geht es darum, Liebe zu ermöglichen. Ohne Freundlichkeit und gute Laune ist das nicht möglich. Davon kann auch die Freiwirtschaft noch lernen.
(In leicht veränderter Fassung wurde diese Rezension erstmals veröffentlicht in: Fairconomy, Jg. 16 / Nr. 1 – März 2020, S. 23)