Peter Kropotkin: Enteignung, Übersetzung aus dem Englischen von Helene Hodor, Wien: Verlag Monte Verità, 2023 (= Edition Wilde Mischung. Vernünftige Texte in schwarzen Heften, hrsg. v. Arno Maierbrugger, Adi Rasworschegg †, Gerhard Senft, Peter Stipkovics; 36), ISBN 978-3-900434-58-8, 74 Seiten, 10,00 €
Rezension von Markus Henning
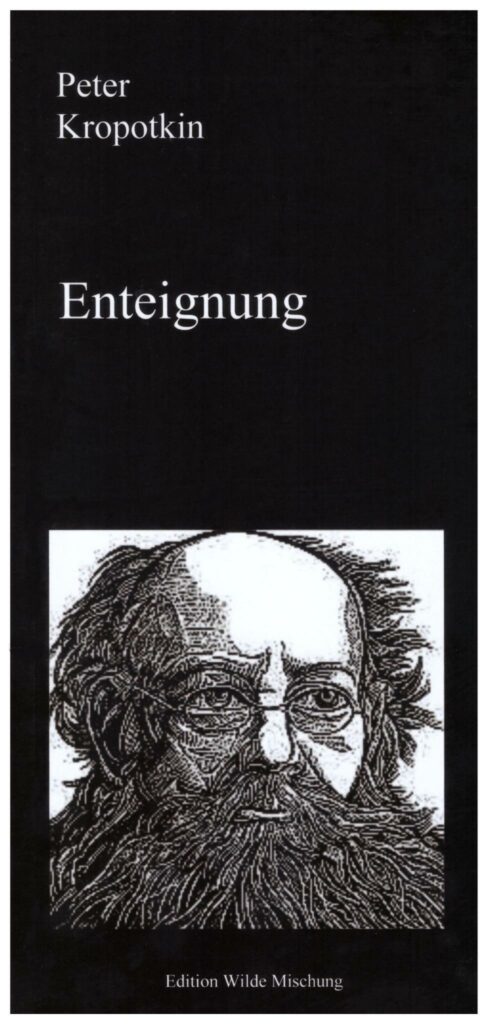
Die Rückeroberung der Zukunft setzt ein Sorgetragen voraus, das menschliches wie nicht-menschliches Leben gleichermaßen umfasst. Eingeübt werden kann es nur als emanzipatorische Praxis, als sichtbarer und erfahrbarer Vorgriff auf andere Möglichkeiten, den gesellschaftlichen Stoffwechsel mit der Natur zu gestalten.
So unspektakulär solche Transformationsansätze oft entstehen und sich im Alltag behaupten – etwa in Form von Nachbarschaftsprojekten oder kleinen Kooperativen –, so wenig kann ihr Anliegen delegiert werden. Wodurch sie über sich hinausweisen, ist das Auf-Dauer-Stellen von Selbstorganisation und Verantwortungsübernahme. Im gemeinschaftlichen Experiment bilden sich Routinen der Kreativität aus. Dazu braucht es die Wiederaneignung öffentlicher Räume. Und es braucht Handlungswissen um Eigentumsmodelle jenseits von Kapital, Staat, Wachstums- und Verwertungszwang.
Um die ökonomischen Narrative des Bestehenden dergestalt hinter sich zu lassen, ist die Recherche von Gegengeschichten bedeutsam. Zu letzteren gehört der Anarchismus. Im Spektrum seiner Traditionslinien schärft sich der Blick für den Zusammenhang, in dem die Herrschaft von Menschen über Menschen mit der Zerstörung ihrer biophysischen Lebensgrundlagen steht. Konstruktivem Neuaufbau und ökologischer Sensibilität tun sich weite Horizonte auf. Sie wollen durchdacht und erprobt werden.
Viele waren an der Wegbereitung beteiligt, darunter auch Peter Kropotkin (1842-1921). Der aus Russland stammende Geograph, Naturkundler und Revolutionär gilt als Begründer einer eigenen Bewegungsrichtung, nämlich des kommunistischen Anarchismus. Wirkmächtig wurde Kropotkin zudem als Kritiker des Sozialdarwinismus. Epochal sind seine Untersuchungen über die Gegenseitige Hilfe als bedeutendem Faktor biologischer und sozialer Evolution: Die Potentiale des Zwischenmenschlichen, die hierüber erkennbar werden, können und sollen zur Entfaltung kommen! Und das nicht als Zukunftsprojektion, sondern als Maxime einer immer schon im Hier und Jetzt zu beginnenden Umwälzung!
So lässt sich auch das Anliegen von Kropotkins Wirtschaftstheorie deuten, wie sie uns in seinem Buch Enteignung begegnet.
Dessen Inhalt fußt auf einer Artikelserie, die Kropotkin zuerst 1882 in der französischen Zeitschrift Le Révolté veröffentlicht hatte. Überarbeitet und erweitert erschien sie vier Jahre später als Band der Londoner Freedom Pamphlets. Auf Grundlage dieser Fassung ist sie jetzt vom Verlag Monte Verità in deutschsprachiger Übersetzung ediert worden.
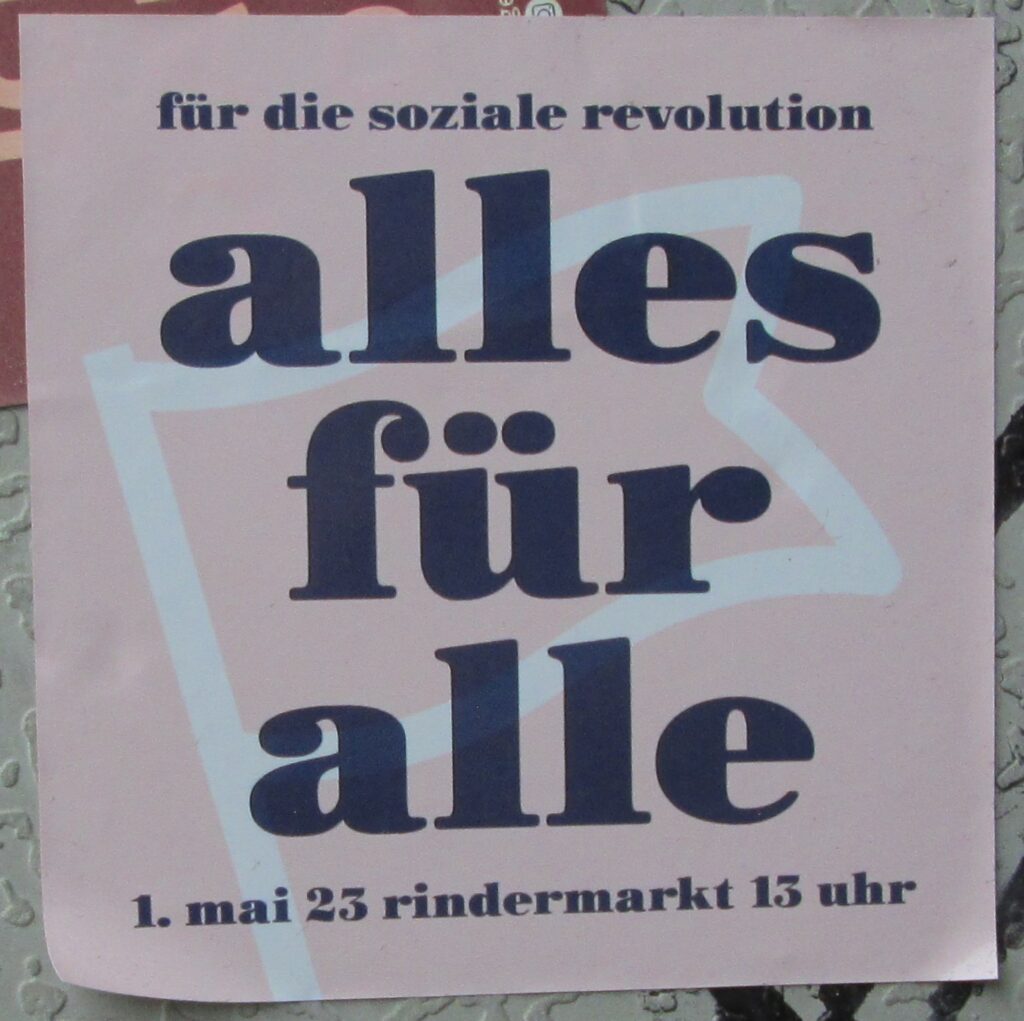
Seine Überlegungen zur bedürfnisorientierten Bewirtschaftung von Gütern, Ressourcen und Infrastrukturen bettet Kropotkin ein in eine Handreichung zum Aufstand. Wie seine ganze Generation ist er geprägt durch die Pariser Kommune von 1871. Der Fokus sozialer Revolution liegt demnach in der Föderation sich selbst ermächtigender Stadtgemeinden. In der Wüste des Bestehenden sind sie die Oasen des Beginnens und der Solidarität. Damit wird ihnen eine Funktion zugeschrieben, die Parallelen aufweist zu den Nischen sozial-ökologischer Transformation unserer Zeit. Wir tun Kropotkins Text also keine Gewalt an, wenn wir versuchen, ihn für eine pragmatische Lesart zu öffnen, die Antworten auf aktuell drängende Fragen sucht.
1) Basisdemokratie. Die beste Schule für Selbstwirksamkeit und Resilienz ist die Ausweitung gesellschaftlicher Teilhabe. Mit Kropotkin kann gesagt werden, dass multipler Krisenhaftigkeit nur mit einer Demokratisierung der Demokratie begegnet werden kann: „Die Leute begehen jede Menge Fehler, wenn sie an den Urnen einen verrückten Kandidaten wählen sollen, der um die Ehre bittet, sie zu repräsentieren und sich anmaßt, alles zu wissen, zu tun und zu organisieren. Aber wenn sie selbst die Organisation in die Hand nehmen für etwas, das sie kennen, sie direkt angeht, so tun sie dies besser als alle Debattierklubs zusammen“ (S. 68 f.). Jede Begegnung auf Augenhöhe, jeder Moment von Selbstorganisation und gemeinschaftlicher Aktivität ist daher ein Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit. Freiwillige Zusammenschlüsse entlang konkreter Bedürfnisse öffnen entsprechende Räume. Kropotkin führt als Ansatzpunkte Häuserblocks, Straßen, Stadtviertel und Gemeinden, aber auch Kultur- und Arbeitsbereiche an. Ob territorial oder funktional gegliedert, wichtig sind Dezentralität und Aufbau von unten nach oben. Wichtig sind Resonanz und Weisungsgebundenheit gegenüber der jeweils unteren Ebene. Und wichtig ist das Hineinwachsen basisdemokratischer Verfahren in immer weitere Gesellschaftssphären.
2) Kommunalisierung. Ökonomien des Ausgleichs und der Selbstbegrenzung können nur in partizipativen Aushandlungen entstehen. Auch dazu ist der räumliche Nahbereich prädestiniert. Für die Suche nach geeigneten Träger- und Betreiberstrukturen stellt Kropotkin Eigentumsformen der Allmende zur Diskussion. Dabei handelt es sich um Vermögenswerte in Gemeindeeigentum, die der Bevölkerung zur gemeinschaftlichen Nutzung, Reparatur und Pflege überantwortet sind. Bei Kropotkin zielt Vergesellschaftung mitnichten darauf ab, staatliche Behörden an die Stelle privater Arbeitgeber treten zu lassen. Sie zielt auf freien Nießbrauch und wirtschaftliche Selbstverwaltung der unmittelbar Tätigen, kann also zum Lernfeld eines fürsorglichen Weltzugangs werden.
3) Zugriffe. Kropotkin empfiehlt, als erstes die Grundversorgung der kapitalistischen Funktionslogik zu entziehen. Die Bereiche, die er hierunter subsumiert, sind auch heute noch wesentlich für den sozial-ökologischen Umbau. Da sind Boden und natürliche Ressourcen. Schon aus naturrechtlichen Gründen darf es an ihnen kein Privateigentum geben: „Wer hat das Recht, irgendeinem Bieter das kleinste Stück des gemeinsamen Erbes zu verkaufen?“ (S. 58). Da ist ein Immobilienmarkt, der Wohnraum und urbanes Leben für immer größere Bevölkerungskreise unerschwinglich werden lässt: „Die Enteignung der Wohnhäuser birgt im Keim die ganze soziale Revolution“ (S. 65). Und da sind die Wertschöpfungsketten für Nahrungsmittel und Industrieprodukte. Sie machen selbst die ökonomischen Verlierer des globalen Nordens noch zu Tätern, da „[…] alle unsere bürgerlichen Gesellschaften auf der Ausbeutung von schlechter gestellten und unterprivilegierten Völkern und Ländern mit weniger fortschrittlichen Industriesystemen basieren […]“ (S. 52 f.).
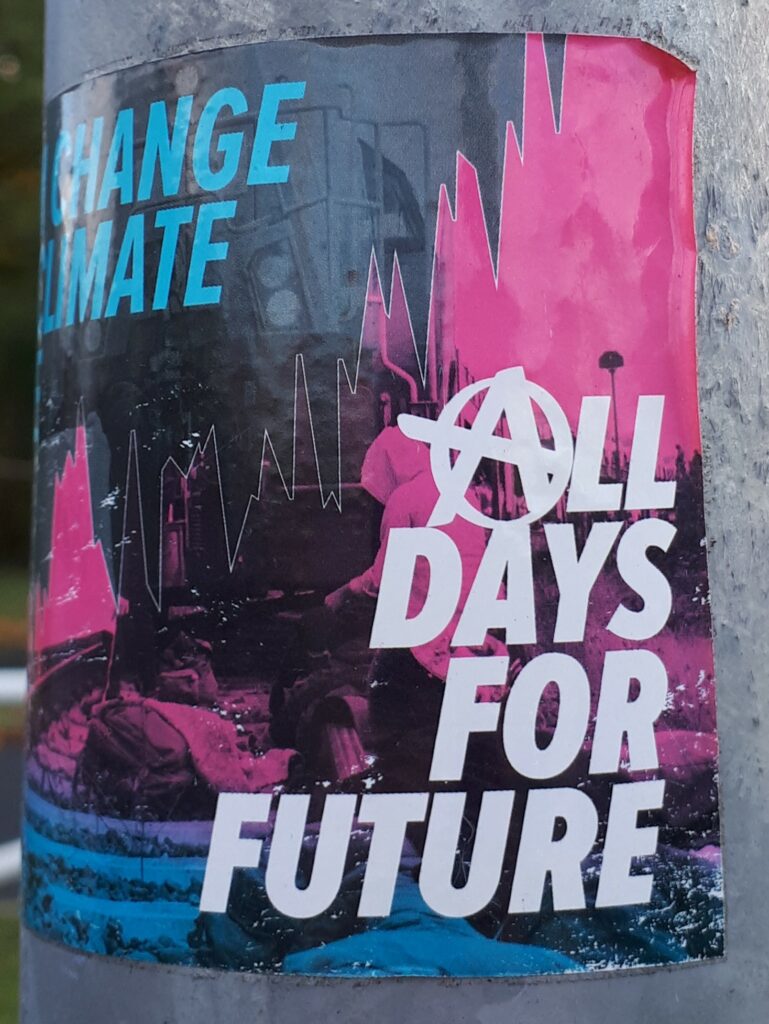
4) Selbstversorgung. Direkte Aktionen sind Kropotkins Mittel der Wahl. In ihnen wird die Selbstbestimmung der Beteiligten zum strukturierenden Prinzip, unberührt vom Regulierungs- und Herrschaftsanspruch politischer Parteien oder Institutionen. Die kollektive Besitzergreifung gewinnt dadurch an Dynamik, dass sie in jedem Augenblick das angestrebte Ziel, also die Allmende-Wirtschaft, bereits ein Stück weit realisiert. Selbst kleine Maßnahmen – und das ist für unsere Fragestellung von Interesse – können auf diese Weise Teil der großen Lösung werden. Für die urbane Versorgung mit Nahrungsmitteln und Energie buchstabiert Kropotkin das beispielhaft aus. Das Szenario, das er entwirft, überrascht nicht allein durch Zeitlosigkeit, etwa wenn es um Alternativen zum fossilen Entwicklungspfad geht: „Wasserdampf, Elektrizität, Sonnenwärme, der Atem des Windes werden über kurz oder lang verstärkt eingesetzt“ (S. 55). Bemerkenswert ist auch die Anschlussfähigkeit für zivilgesellschaftliche Initiativen, wie sie sich in vielen Ländern der Welt während der vergangenen Jahrzehnte entfaltet haben – meist ohne historischen Rückbezug; mal mit, mal ohne kommunale Unterstützung. Wir denken an Projekte solidarischer Landwirtschaft, an Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften oder an Bewegungen wie Urban Gardening und „Essbare Stadt“. Für ihre Selbstreflektion und das Wachküssen weitergehender Perspektiven könnte sich bei Kropotkin ein Ideenreservoir auftun. Eingedenk der unübersehbaren Vielfalt von Stadtregionen und Nachbarschaften weiß er um die Untauglichkeit von Einheitslösungen. Seine Vorschläge schwingen sich ein in einer nach vorne offenen Doppelstrategie: Auf der einen Seite geht es um Brücken zwischen Stadt und Land, d.h. um lokale Vernetzungen selbstverwalteter Handwerks-, Industrie- und Handelsbetriebe mit landwirtschaftlichen Produktionsstätten. Durch eine gebrauchswertorientierte Umstellung von Produktion und Austausch könnten innerhalb dieser Assoziationen geschlossene Wirtschaftskreisläufe implementiert werden. Auf der anderen Seite umreißt Kropotkin ein Panorama innerstädtischer Subsistenz. Deren Grundlagen wären die Enteignung und Kommunalisierung entsprechender Areale, das basisdemokratische Zusammenfließen menschlicher Schwarmintelligenz und der Aufbau von Prosumentenzellen: „Also, indem man die Kunst des Gartenbaus von Fachkräften erlernt und auf verschiedene Weise Experimente auf kleinen, zu diesem Zweck angelegten, Bodenflächen versucht, sich gegenseitig überbietend, um die besten Erträge zu erzielen, in körperlicher Betätigung – ohne Erschöpfung oder Überarbeitung – die Gesundheit und Stärke wieder findend, welche in Städten so oft nachlässt, werden die Männer, Frauen und Kinder sich gerne der Arbeit auf den Feldern zuwenden, wenn es sich nicht um sklavenhafte Plackerei handelt, sondern zum Vergnügen wird, ein Fest, eine Wiedererlangung von Gesundheit und Freude. […] Bitte die Erde und sie wird dir Brot geben, sofern du in angemessener Weise fragst“ (S. 55).
Die Gegenwart ist immer auch das Echo vergangener Stimmen. Die von Peter Kropotkin können wir jetzt wieder deutlich vernehmen. Seine Ausführungen über die revoltierende Stadt machen uns immer noch hellhörig. Nicht weil jedes Wort denselben Klang hätte wie im vorletzten Jahrhundert. Sondern weil er davon kündet, dass der zerstörerischen Ordnung nur durch anarchistische Intervention beizukommen ist. Es ist unsere Aufgabe, daraus einen neuen Munizipalismus zu entwickeln, in welchem Zivilgesellschaft und Kommunalverwaltungen kooperativ für die sozial-ökologische Transformation wirken.
Peter Kropotkins Enteignung ist ein wichtiger Anstoß. Wir wünschen seinen Herausgebern viel Erfolg mit diesem schmalen, gehaltvollen Buch.