Ulrich Brand / Markus Wissen: Kapitalismus am Limit. Öko-imperiale Spannungen, umkämpfte Krisenpolitik und solidarische Perspektiven, München: oekom verlag, 2024, ISBN: 978-3-98726-065-0, 304 Seiten, 24,00 €
Rezension von Markus Henning
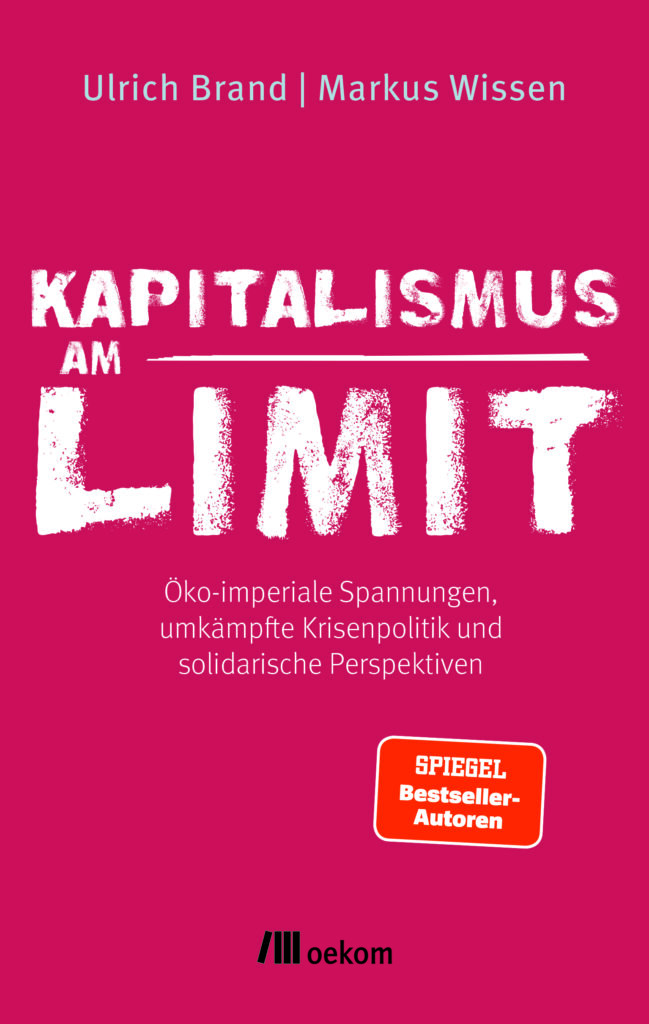
Wissenschaft kann gleichzeitig Warnung sein und an die Gestaltbarkeit der Welt erinnern. Sie trainiert unsere Fähigkeit, im Jetzt anzukommen, transformative Möglichkeiten in den Blick zu nehmen und das Ausgeliefertsein hinter uns zu lassen.
Unsere Alltagsroutinen sind eingewoben in die Strukturen expansiver Lebens- und Naturzerstörung. Nur wenn wir das mitdenkend und mitfühlend anerkennen, können wir statt des destruktiven in ein fürsorgliches Weltverhältnis eintreten.
Uns dergestalt handlungsfähig zu machen, ist das Projekt der beiden Sozialwissenschaftler Ulrich Brand (geb. 1967) und Markus Wissen (geb. 1965). Im Diskurs der Kapitalismuskritik sind sie keine Unbekannten. Bereits im Jahr 2017 bereicherten sie die Auseinandersetzung durch ihr Konzept der Imperialen Lebensweise.
Dieses beschreibt die Dynamik der vorherrschenden Produktions- und Konsummuster aus Perspektive der Hegemonietheorie. Dabei geht es um mehr als um Ökonomie. Es geht nicht nur um Ausbeutung und Ungleichheit, um Akkumulation und Wachstumszwang, um den Neokolonialismus globaler Wertschöpfungsketten oder um die Kapitalisierung auch noch der letzten Lebenssphären. Es geht vor allem um die Frage, wie sich diese monströse Normalität kulturell verankert. Über welche Mechanismen werden Menschen in sie hineinsozialisiert? Wie erzeugt sie Zustimmung – auch bei denjenigen, die materiell dadurch eher verlieren als gewinnen?
Auf der Suche nach Antworten weitet sich die Analyse. Erkennbar werden historisch spezifische Formen von Herrschaft und existentieller Abhängigkeit, z.B. in den Infrastruktursystemen agrarindustrieller Ernährung, fossiler Energieversorgung oder autozentrierter Mobilität. Sie lassen oftmals keine andere Wahl, als an der Imperialen Lebensweise zu partizipieren. Von dieser Seite aus betrachtet, handelt es sich um ein gesellschaftliches Zwangsverhältnis.
Auf der anderen Seite ist die Imperiale Lebensweise aber auch ein Ermöglichungsverhältnis. Mit Erwerbsarbeit, Einkommen und Warenkonsum verheißt sie ein permanentes „So-weiter-wie-bisher“. Ihr Zukunftsentwurf ist die Verewigung der Gegenwart. Deren Attraktivität bleibt freilich nur so lange ungebrochen, wie ihre Schattenseiten abgewälzt werden können: Auf andere Weltgegenden, auf randständige Bevölkerungsgruppen, auf unbezahlte Reproduktionsarbeit oder auf künftige Generationen.
Genau diese Funktionsbedingung gerät jetzt ins Wanken. So lautet die Zeitdiagnose, die Ulrich Brand und Markus Wissen in ihrem neuen Buch vorstellen. Es ist im Münchener oekom Verlag erschienen und trägt den Titel Kapitalismus am Limit:
„Die Mechanismen der Externalisierung greifen immer weniger, denn die geographischen Räume und gesellschaftlichen Sphären, auf die sich die sozial-ökologischen Kosten der kapitalistischen Produktionsweise in der Vergangenheit verlagern ließen, schrumpfen: Die natürlichen Senken sind mit der Aufnahme der Emissionen, die beim Produzieren und Konsumieren entstehen, überfordert; wichtige Rohstoffe gelten zunehmend als ‚kritisch‘; und die Aneignung und Ausbeutung von Arbeitskraft geraten an ihre Grenzen“ (S. 82 f.).
Selbst in Ländern des globalen Nordens kann von dauerhafter Stabilität keine Rede mehr sein. Zu eruptiv brechen die ökologischen Katastrophen mittlerweile auch in ihren Alltag ein. Zu sehr steht ihr Ressourcenzugriff in globaler Konkurrenz mit neuen Zentren der Kapitalakkumulation. Und zu bedrohlich überträgt sich der Legitimationsverlust auf die Institutionen der liberalen Demokratie. Neue Hegemonieprojekte treten auf den Plan.

Die politischen Strategien von Rechtspopulismus und Neofaschismus können als Versuche begriffen werden, die in die Krise geratene Imperiale Lebensweise autoritär zu stabilisieren. Unterstützt von fossilen Kapitalfraktionen verbinden sie die Leugnung menschengemachten Klimawandels mit Ausgrenzung und Abschottung. Vertikale Klassenwidersprüche werden rassistisch codiert und in Innen-Außen-Gegensätze umgedeutet. Petromaskuline Anrufungen versprechen einer verunsicherten weißen Männlichkeit die Wiederherstellung von patriarchaler Dominanz, völkischer Hierarchie und motorisiertem Geschwindigkeitsrausch.
Aber auch die Strategien eines Grünen Kapitalismus beinhalten keine Überwindung, sondern zielen faktisch auf eine Ausweitung und Vertiefung der Imperialen Lebensweise. Das zeigen Ulrich Brand und Markus Wissen am Beispiel des European Green Deal (EGD). Er hat sich auf supranationaler Staatsebene die Klimaneutralität europäischen Wirtschaftens bis zum Jahr 2050 zum Ziel gesetzt. Der Staat allerdings ist kein neutraler Akteur. „Staatliche Politik im Kapitalismus ist strukturell begrenzt durch gesellschaftliche Orientierungen und tief verankerte Herrschaftsverhältnisse, die sich in die staatlichen Apparate (Ministerien, Parlamente oder Notenbanken) einschreiben, vom staatlichen Personal verinnerlicht werden und den Horizont dessen abstecken, was politisch als möglich gilt. […] Grundlegende sozial-ökologische Alternativen können auf den staatlichen Terrains deshalb kaum sichtbar gemacht werden, geschweige denn sind sie verhandelbar“ (S. 16 u. S. 121). Als Projekt öko-kapitalistischer Modernisierung ist der Möglichkeitsraum des EGD daher begrenzt durch den Imperativ von Akkumulation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Die daraus resultierenden Zielkonflikte sind ohne neuen Ressourcenkolonialismus nicht zu lösen. Technische Systeme zur Produktion und Distribution erneuerbarer Energien benötigen metallische, mineralische und fossile Rohstoffe. Unter der Bedingung kapitalistischen Wachstums muss die dringend gebotene Dekarbonisierung daher zu weiter eskalierendem Raubbau führen: In den ressourcenreichen Ländern des globalen Südens, auf Kosten von Mensch, Natur und um den Preis internationaler Spannungen.
Auch im Hegemonieprojekt der ökologischen Modernisierung wird der funktionale Zusammenhang greifbar, der den Kapitalismus mit klassen- und geschlechtsspezifischer, mit rassistischer und kolonialer Herrschaft verbindet. Erst deren Überwindung würde die Voraussetzung schaffen für ein Ende von Verwertungszwang und Naturzerstörung.
Auf wissenschaftliche Appelle an Regierungen, Staaten und Unternehmen setzen Ulrich Brand und Markus Wissen keine Hoffnung. Stattdessen plädieren sie für politische Subversion: Für die Bildung transformativer Zellen in organisierten Interessenvertretungen und in sonstigen Lebensbereichen, für solidarisch gelebte alltägliche Beziehungen, für Projekte eines gebrauchswertorientierten Wirtschaftens und für den damit einhergehenden Wandel von Gewohnheiten und Subjektivitäten.
„Viele dieser Ansätze konvergieren in der Degrowth- und Postwachstumsdebatte, die sich in jüngerer Zeit sehr dynamisch entwickelt hat. In ihr gehen kapitalismuskritische, dekoloniale und feministische Ansätze, kritische Sozialwissenschaft und emanzipatorischer Aktivismus eine sehr lebendige und fruchtbare Verbindung ein. Ausgehend von einer Vielzahl von Kämpfen um eine sozial-ökologische Alternative zum Bestehenden wird die reale Utopie einer Welt entwickelt und in Ansätzen praktiziert, die die absolute Reduktion des Ressourcenverbrauchs und der Umweltbelastung mit einem Zuwachs an Gleichheit und Demokratie verknüpft“ (S. 25 f.).

Wesentlich sind die grundlegenden Veränderungen, die in konkreten Reformen bereits aufscheinen. Idealerweise öffnen sie Horizonte einer emanzipatorischen Krisenpolitik.
1) Solidarische Begrenzungen. Nur wenn es gelingt, den expansiven Charakter der Imperialen Lebensweise zurückzudrängen, ist ein gutes Leben für alle möglich. In gesellschaftlichen Lernprozessen könnten andere Werte und Formen eines qualitativen Wohlstands erfahrbar werden. Ziel wäre eine „Ethik kollektiver Selbstbegrenzung“ (S. 214) bzw. eine „Kunst des sorgfältigen Minimalismus“ (Ulrich Grober, zit. in: S. 271). Die ihr entsprechenden Regeln selbstbestimmter Suffizienz würden es Menschen ermöglichen, nicht länger auf Kosten anderer und auf Kosten der Natur leben zu müssen.
2) Vergesellschaftung basaler Infrastrukturen. Kriterium der Entkapitalisierung wäre die Reproduktionsnotwendigkeit des jeweiligen Bereichs. Hierunter fällt für Ulrich Brand und Markus Wissen auch die Agrarwirtschaft. Eine Erwägung, die aus Sicht der freiwirtschaftlichen Bodenreform von besonderem Interesse ist: „Das Landwirtschafts- und Ernährungssystem zu vergesellschaften würde nicht bedeuten, dass es keine selbständig wirtschaftenden Betriebe mehr gäbe. Jedoch wäre deren Größe beschränkt. Vor allem aber wäre die Verfügungsgewalt über den Boden vergesellschaftet oder genossenschaftlich organisiert. Es gäbe beispielsweise keine Finanzinvestoren mehr, die sich riesige Landflächen unter den Nagel reißen, um aus der agrarindustriellen Produktion von Lebensmitteln oder Energiepflanzen Profit zu schlagen. Die Bodenvergabe würde stattdessen demokratisch kontrolliert und an eine solidarische und sozial-ökologische Bewirtschaftung gebunden“ (S. 218). Ähnlich strukturkreativ könnte auch bei anderen basalen Infrastrukturen vorgegangen werden, z.B. beim Wohnen, bei der Mobilität, bei der Wasser- und Energieversorgung, im Pflege- und Gesundheitsbereich etc.
3) Solidarische Resilienz und Reparatur. Der sich wechselseitig bedingende Abbau von sozialer Herrschaft und von Naturbeherrschung könnte auch die Grundlage bilden für eine solidarische Bewältigung der Klimakrise, ihrer sozial-ökologischen Schäden und Verluste. Klimareparationen – z.B. in Form von Schuldenerlassen, Technologietransfer, Unterstützung bei Anpassung oder Renaturierung – wären ein unabdingbarer Baustein für die Neugestaltung der Weltwirtschaft. „Adressat*innen von Reparatur- und Wiedergutmachungsleistungen sind oft enteignete indigene Völker, übrigens auch im globalen Norden. […] Die Zahlungen für die erlittenen und noch folgenden Schäden sollen von den verantwortlichen Unternehmen und Ländern geleistet werden“ (S. 229).
4) Freiheit und Bleiberecht. Transformative Gerechtigkeit braucht ein emanzipatorisches Verständnis von Freiheit. Ein solches hat immer auch die Angewiesenheit auf andere und auf die biophysischen Lebensgrundlagen zu reflektieren. Der liberale Freiheitsbegriff der Moderne stellte auf zunehmende Mobilität und Handlungsreichweite ab. Was in Zeiten der Klimakrise wichtig wird, ist die „Bleibefreiheit“ (Eva von Redecker, zit. in: S. 234). Sie zielt auf Verantwortungsübernahme und Gestaltungswille, auf ein erfülltes Leben der Kooperation und gegenseitigen Hilfe, und zwar in einer Gesellschaft, die fortdauert und sich nicht weiter ruiniert.
In den Momenten unseres Lebens, in denen wir aus Bequemlichkeit zur Verzweiflung neigen, brauchen wir Autoren wie Ulrich Brand und Markus Wissen. Sie verstehen sich selbst als Teil der emanzipatorischen Praxis, zu deren Orientierung sie beitragen wollen. Das macht die Lektüre ihres Buches so lohnend. Kapitalismus am Limit steht auf Höhe der Zeit. Es rüttelt auf, ermahnt uns, die Schultern zu straffen und unser Bestes zu tun.
Hiervon sollte sich auch die freiwirtschaftliche Diskussion mitreißen und inspirieren lassen. Anknüpfungspunkte gibt es zur Genüge.